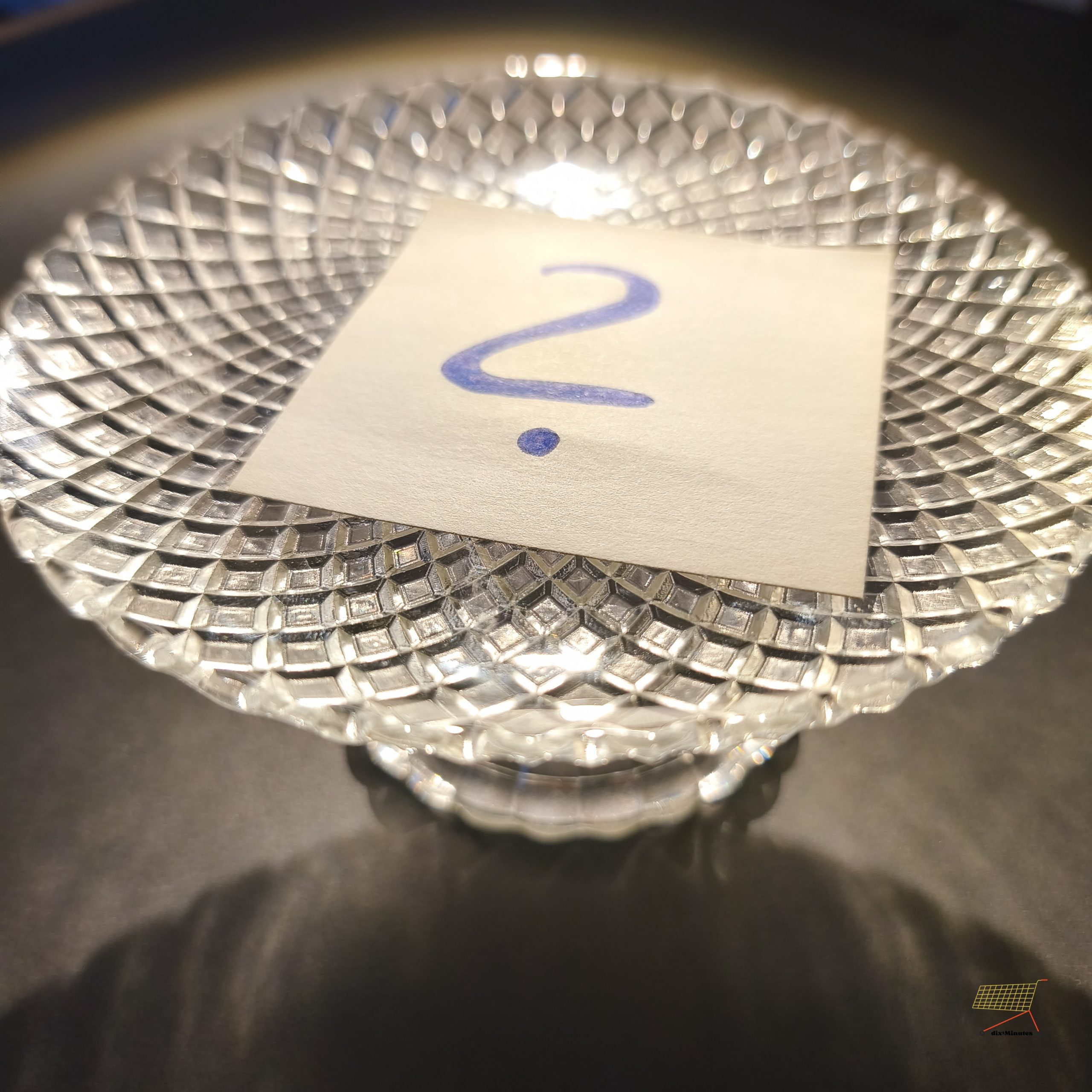Mein Atem geht rasch, fast stoßweise und der Schweiß beißt mir ein wenig in den Augen aber ich versuche nicht aufzugeben. Ich versuche ebenfalls weder nach oben zu schauen, um zu sehen, wie weit es noch ist, noch daran zu denken, wie die Abfahrt wird. In diesem Terrain. Schotterpisten, sehr steile Schotterpisten rauf zu fahren ist (nur) körperlich anstrengen, runter dagegen empfinde ich es bisweilen als gefährlich und damit mental anstrengend. Ich alte Schisserin. Da hilft im schlimmsten Fall, das Rad zu schieben. Mache ich dann auch, will ich aber nicht. Ist halt doof. Hin und her gerissen zwischen diesen Gedankengängen suche ich meine Linie.
Die Kunst ist es, meinen Weg zwischen Schlaglöchern, sandigem Untergrund und dabei größeren Steinbrocken auszuweichend, zu finden. Das lenkt mich ein wenig ab. Es wackelt und ruckelt, die Kette schlägt an den Rahmen, das Hinterrad bekommt keinen Grip, meine Hände ziehen am Lenker, ziehen mich hinauf. Ich balanciere und versuche in der mir größtmöglichen Geschwindigkeit die Hindernisse zu umfahren oder drüber hinweg zu rollen. Linie – wo lang? Immer wieder dieser eine Gedanke. Wo lang? Wie im Leben, stelle ich fest.
Sobald der Untergrund besser und weniger steil wird, lasse ich zur Belohnung meinen Blick über die grandiose Landschaft schweifen. Ich rieche bewusst die Brise, die vom Meer aufsteigt und Kühlung bringt. Den Pinienduft in der Mittagshitze. Ablenkung ist alles. Ruhig ist es hier fern des Autoverkehrs. Tatsächlich ertappe ich mich zwischendurch bei dem Gedanken: ist gar nicht so schlimm. Wer sagt es denn! Allerdings genieße ich die Abfahrt dann in vollen Zügen, als die Straße deutlich besser wird, bergab und ins nächste Dorf führt. Dort angekommen, singen wir ein Hohelied auf die Automatenstation, die uns notfallmäßig schnell und unverfänglich mit Getränken und Chips versorgt und danach gibt’s noch ein Eis. Yippie – geschafft.